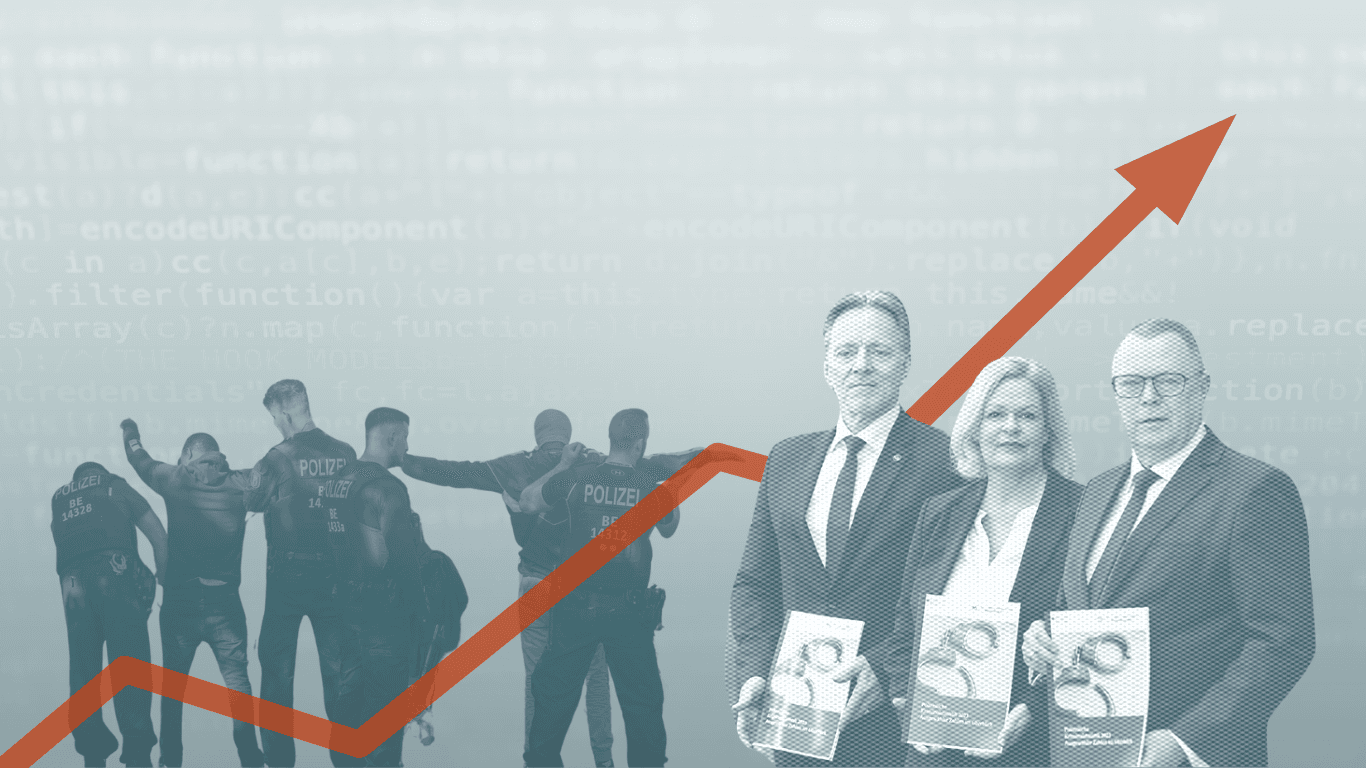Fall 24
| Fallnummer | 24 |
| Anklage | Körperverletzung, Verstoß gegen BtMG, Sonstige |
| Verteidigung anwesend | Ja |
| Übersetzung anwesend | Ja |
| Rassifizierte Person | Ja |
| Ausgang | Haftstrafe |
Das Gericht verhandelt einen Fall, in dem ein junger Mann wegen mehrerer Delikte angeklagt ist, darunter Drogendelikte, Körperverletzung und Raub, wobei mehrfach ein Messer verwendet wurde. Nach sechs Anhörungen, die hauptsächlich aus der Vernehmung von Polizeizeugen bestehen, wird der Mann zu einer Gefängnisstrafe und einer Drogentherapie im Maßregelvollzug mit einer Gesamtdauer von fast sieben Jahren verurteilt. Das Gericht geht während der Verhandlung nicht auf die Bedürfnisse der Opfer ein: Stattdessen werden ihnen Suggestivfragen gestellt, die der Rechtfertigung einer harten Strafe dienen, und das Gericht macht sich stellenweise über sie lustig. Der strukturelle Kontext der Taten des Angeklagten wird in dem Verfahren weitgehend ausgeblendet.
Politiker*innen und Medien konstruieren derzeit eine moralische Panik über „Messerkriminalität“. Dies dient dazu, die Ausweitung polizeilicher Befugnisse und repressiver Maßnahmen zu rechtfertigen, die sich in erster Linie gegen arme und migrantisierte Menschen richten. Ein zentrales Argument für das harte Vorgehen gegen sogenannte „Messerkriminalität“ ist die Vorstellung, dass Strafe Sicherheit schafft. Dieser Fall zeigt jedoch, dass das Strafsystem nicht in der Lage ist, Schäden zu beheben und echte Gerechtigkeit herzustellen. Vielmehr entzieht sich der Staat seiner Verantwortung für die Versorgung von Menschen, die Zugang zu Wohnraum, medizinischer Versorgung und anderen grundlegenden Bedürfnissen benötigen. Diese Versorgungslücke zeigt sich sowohl in Hinblick auf den Angeklagten als auch auf die Opfer. Der Angeklagte ist ein junger Migrant, der aufgrund begrenzter legaler Möglichkeiten auf kriminalisierte Einkommensmöglichkeiten angewiesen ist. Sein Drogenkonsum wird als individuelles moralisches Versagen behandelt. Die Vorfälle ereigneten sich alle in einem Gebiet, das von der Polizei stark kontrolliert wird und das in den Medien als „Kriminalitätsbrennpunkt“ und „No-go-Area“ dargestellt wird. Im Laufe des Prozesses machte das Gericht die Opfer dafür verantwortlich, dass sie sich am falschen Ort aufhielten, und stellte Verdächtigungen auf, dass diese selbst in Straftaten verwickelt seien. Diejenigen, die nicht vor Gericht aussagen wollten, wurden als unkooperativ charakterisiert und das Gericht versuchte, ihr Erscheinen mit Gewalt zu erzwingen, unter anderem durch Androhung von Geldstrafen und Inhaftierung. Die Richter machten sich wiederholt über rassifizierte Opfer in deren Abwesenheit lustig, während sie gleichzeitig den Schaden, den diese erlitten, als Begründung für ein hartes Urteil gegen den Angeklagten anführten. Darüber hinaus wurde polizeiliches Fehlverhalten, wie z. B. die unzureichende Behandlung der Verletzungen der Opfer nicht näher erörtert. Der Angeklagte wird nun seiner Freiheit beraubt, seine Möglichkeiten, medizinische Versorgung zu erhalten, werden weiter eingeschränkt und vermutlich wird er im Anschluss an seine Strafe abgeschoben. Letztlich bleibt bei diesem Fall mehr als fragwürdig, inwiefern die harte Bestrafung dieses jungen Mannes Gerechtigkeit oder Sicherheit schafft.
Dem Angeklagten werden mehrere Drogen-, Körperverletzungs- und Raubdelikte vorgeworfen, bei denen er teilweise ein Messer benutzt hat. Im Rahmen unserer Prozessbeobachtung haben wir drei Themen identifiziert, die sich dabei herauskristallisierten und diese zur Strukturierung eines gekürzten Berichts verwendet.
Keine Zweifel am Wahrheitsgehalt von Polizeiaussagen
Bei jedem Anklagepunkt wegen Raubes oder Körperverletzung wurden der jeweilige Vorfall und seine Umstände in erster Linie von Polizeibeamten geschildert, die zur Erstattung einer Anzeige gerufen wurden, oder die an der Verhaftung des Angeklagten beteiligt waren. In einigen Fällen war die polizeiliche Aussage das einzige Beweismittel, das herangezogen wurde, weil einige Opfer nicht vor Gericht erschienen oder von Polizei und Staatsanwaltschaft nicht erreicht werden konnten, um auszusagen. In den meisten Fällen traf die Polizei erst ein, nachdem sich der mutmaßliche Vorfall ereignet hatte, sodass sich die Zeugenaussagen auf Beschreibungen aus zweiter Hand von befragten Geschädigten oder am Tatort gefundenen Beweisen stützten.
Ein Polizeizeuge beschreibt ein Opfer eines mutmaßlichen Übergriffs als jemanden, der „der Polizei bekannt ist“ und fügt dann hinzu: „Ich meine... Phänotyp Schwarzafrikaner“ und bezeichnet den Zeugen als äußerst unkooperativ. Der festnehmende Beamte beschreibt den Angeklagten ebenfalls anhand eines „Phänotyps“ und sagt aus, dass er könne sicher sein, die richtige Person festgenommen zu haben, weil er „sein Gesicht kannte“, obwohl er nicht Zeuge der Auseinandersetzung war und den Verdächtigen während der Verfolgung kurzzeitig aus den Augen verloren hatte. Im Rahmen ihrer Aussagen spekulieren alle vier Beamten trotz mangelnder Hinweise über den Drogenkonsum sowohl des Angeklagten als auch des jeweiligen Opfers. Nur ein Beamter, der das Opfer Stunden nach dem Vorfall aus unbekannten Gründen erneut befragte, sagte aus, dass er einen Atemalkoholtest durchführte und Alkohol im Blut des Geschädigten fand.
Ausnahmslos alle Opfer in diesem Fall wurden von der Polizei zu ihrem Drogenkonsum befragt, und diejenigen, die vor Gericht aussagten, wurden intensiv befragt, warum sie sich in einer Gegend aufhalten würden, in der Drogen verkauft werden. In zwei Fällen behauptete die Polizei, dass das Opfer und der Angeklagte sich zu kennen schienen und dass es wahrscheinlich zu einem Streit zwischen ihnen kam, nachdem sie versucht hatten, Drogen zu kaufen. Diese Vermutung spiegelt sich auch in den Polizeiberichten wider. Obwohl die Opfer gegenüber der Polizei und dem Gericht eindeutig erklärten, dass sie keine Beziehung zu dem Angeklagten hatten, wiederholten die Polizeibeamten ihre Darstellung vor Gericht.
Feindseliger und missachtender Umgang mit Betroffenen vor Gericht
An verschiedenen Stellen der Befragung der Opfer suggeriert das Gericht, dass zumindest ein Teil der Schuld für die erlittenen Schäden bei ihnen liege, weil sie sich nachts in bestimmten Gegenden aufhielten. Gegen Ende ihrer jeweiligen Aussage werden die Opfer gefragt, wie sich das Ereignis auf sie ausgewirkt hat und ob sie dadurch Veränderungen in ihrem Leben erfahren haben. Das Gericht fragt jede Person ausdrücklich, ob sie „jetzt bestimmte Gegenden spät in der Nacht meiden“. Viele Opfer scheinen diese Frage des Richters als Test aufzufassen, um zu sehen, ob sie ihre Lektion gelernt haben, und einige antworten nach kurzem Zögern mit „Ja“. Diese Antwort wird schließlich im Urteil als Beweis für den tiefen psychologischen Schaden angeführt, den der Angeklagte angeblich verursacht habe, und dient als Begründung für eine harte Gefängnisstrafe.
Das Gericht machte die Opfer nicht nur mitverantwortlich, sondern verhängte auch Sanktionen gegen Opfer, die nicht aussagen wollten. Einer Person, die nicht mit der Polizei zusammenarbeiten wollte und wiederholt als unkooperativ bezeichnet wurde, wurde zu Beginn des Prozesses eine polizeiliche Vorladung und eine Geldstrafe auferlegt, um sie zur Teilnahme an der Verhandlung zu zwingen. Erst in der letzten Verhandlung ließ das Gericht die polizeiliche Vorführung und die Geldstrafe fallen, da festgestellt wurde, dass die Briefe an die falsche Adresse geschickt worden waren. Anstelle des Betroffenen wurden vier Beamte als Zeugen geladen. Keiner der vier Beamten, die mit dem Opfer zu tun hatten, leistete medizinische Hilfe bei den Kopfverletzungen des Opfers, was vom Gericht während ihrer Zeugenaussage nicht weiter hinterfragt wurde. Das Gericht machte sich offen über den nicht anwesenden Geschädigten lustig, weil er einen ähnlichen Namen wie ein anderer Geschädigter in dem Fall hatte und verlautete, man müsse aufpassen, dass man nicht die falsche Person bestrafe und vorführe. Der Richter machte in Abwesenheit der Opfer wiederholt abfällige Bemerkungen, wie z. B. Spekulationen über das Verhältnis eines der Geschädigten zur Kriminalität auf der Grundlage eines vermeintlichen „Straßennamens“, den ein Polizeibeamter notiert hatte.
Betroffene, die als Zeugen geladen waren, wurden wiederholt nicht über Änderungen der Anhörungstermine informiert. Außerdem versendete das Gericht drei Vorladungsschreiben fehlerhaft. Ein Opfer wurde aufgefordert, eine gerichtliche Vorladung an einen anderen Zeugen per Messenger zu versenden, anstatt die Ladung schriftlich zu übermitteln. Dieser Person entgingen durch die Terminänderungen zwei Tage ihres Einkommens, und ihr wurden keine korrekten Formulare für die Beantragung einer Zeugenentschädigung ausgehändigt. Als die Person den Richter darauf hinwies, dass die befreundete Person möglicherweise ebenfalls arbeiten müsse und kurzfristig nicht verfügbar sei, antwortete der Richter: „Das Gericht hat Vorrang.“
Schließlich wurden die Geschädigten zu verschiedenen Zeitpunkten des Verfahrens der Gefahr einer Kriminalisierung ausgesetzt. Ein Mann, der mutmaßlich in eine Körperverletzung und einen Raub verwickelt war, wurde wiederholt gefragt, ob es bei der Auseinandersetzung um Geld gegangen sei, ob das Opfer dem Angeklagten wegen seiner Drogengeschäfte Geld geschuldet habe und ob er versucht habe, bei dem Angeklagten Drogen zu kaufen. Obwohl der Geschädigte angab, den Angeklagten nicht zu kennen und auch keine Drogen gekauft zu haben, sondern lediglich in der Gegend zu wohnen und auf dem Heimweg vom Einkaufen zu sein, stellte das Gericht seine Aussage in Frage und befragte drei weitere Zeugen (darunter zwei Polizeibeamte), ob sie glaubten, der Geschädigte habe Drogen konsumiert. Nachdem beide Zeugen ausgesagt hatten, dass der Geschädigte nach dem Vorfall etwas verwirrt wirkte, begann das Gericht, dessen Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Der Richter fragte den Polizeibeamten direkt, ob sie das Opfer auch verdächtigt hätten, eine Straftat begangen zu haben, als sie seine Aussage auf dem Polizeirevier aufnahmen. Der Polizeibeamte bestätigte, dass der Besitz der Person durchsucht und er zu seinem Drogenkonsum befragt wurde.
Kriminalisierung und Pathologisierung von Drogenkonsum
Durch seine Bewährungsakte und eine forensische Sachverständige erfahren wir einige Hintergründe über den Angeklagten. Sein Bewährungsbericht enthält Details über seine sozialen Umstände und sein Verhältnis zum Strafsystem: unter anderem, dass er aufgrund eines unklaren Aufenthaltsstatus keine Sozialhilfe erhält, dass ihm in der Vergangenheit schwere Drogenprobleme attestiert wurden, dass er aber keine Therapie erhält und nicht für ein Substitutionsprogramm angemeldet ist.
Eine gerichtsmedizinische Sachverständige sagt aus. Ihr Bericht ist für das Gericht wichtig zur Bewertung, ob der Drogenkonsum des Angeklagten als mildernder Umstand anzuerkennen ist, und ob er seine Strafe in der Sicherheitsverwahrung verbüßen sollte. In einer frühen Anhörung erklärt sie, dass sie den Angeklagten zum Zeitpunkt der Ereignisse als schwer drogenabhängig einschätze, dass sich seine Abhängigkeit aber seit seiner Inhaftierung gebessert habe. Bei der Vernehmung von Zeugen befragt sie diese zu ihrer Wahrnehmung des Zustands und der Kleidung des Angeklagten. Diese Art der Befragung wird schließlich auch von den Richtern übernommen, die anscheinend versuchen, sich ein Bild von dem „Milieu“ zu machen, in das sie offenbar den Angeklagten und teilweise auch die Opfer einordnen. So stellt das Gericht den Zeugen beispielsweise Fragen zur Kleidung und zum Gesundheitszustand des Angeklagten, zu seiner Hygiene und dazu, ob er wie jemand aussieht, der möglicherweise wohnungslos ist.
Die Sachverständige legt dem Gericht am Ende der Verhandlung ein Gutachten vor, in dem sie die klinische Abhängigkeit des Angeklagten von Drogen und die Auswirkungen seines Drogenkonsums auf die Strafzumessung beurteilt. Sie beginnt damit, Einzelheiten über die Jugend des Angeklagten und seine Flucht nach Europa zu schildern, die er ihr bei einem Besuch im Gefängnis geschildert habe. Viele der Gewalterfahrungen, die der Angeklagte in seiner Kindheit während der Flucht und danach gemacht hat, scheinen bei den Richtern keine Reaktionen hervorzurufen. Die Sachverständige erklärt, dass der Angeklagte die Schule in Deutschland nicht beendet habe, weil „es Probleme gab“, womit sie andeutet, dass der Angeklagte diese Probleme verursachte. Später sagt sie jedoch, der Angeklagte habe umziehen müssen, um eine andere Schule zu besuchen, weil er von Mitschülern rassistisch schikaniert worden sei und diese ihn wiederholt mit dem N-Wort beschimpft hätten. Die Sachverständige, eine weiße Frau, spricht das Wort offen aus.
Die Sachverständige diagnostiziert dem Angeklagten eine schwere klinische Abhängigkeit von mehreren Substanzen. Sie wiederholt, dass die Schwere der Abhängigkeit des jungen Mannes ernst zu nehmen sei, da sie ihn dazu gebracht habe, alle anderen Aspekte des Lebens zu vernachlässigen, und hebt hervor, dass er sich ab dem Zeitpunkt des Drogenkonsums nicht um eine Wohnung, einen Arbeitsplatz oder seinen Aufenthaltsstatus gekümmert habe. Dennoch ist sie der Meinung, dass er zwischen „richtig und falsch“ unterscheiden könne und dass die Straftaten alle als „Beschaffungsdelikte“ zu betrachten seien. Sie diagnostiziert bei ihm keine psychischen Probleme und kommt daher zu dem Schluss, dass er seine Strafe nicht in der Sicherheitsverwahrung verbüßen sollte. Sie empfiehlt jedoch, dass er im Maßregelvollzug, notfalls mit Zwang, eine Entzugstherapie machen sollte.
Alle Prozessbeteiligten, einschließlich des Verteidigers, stellen direkte Verbindungen her zwischen dem Drogenkonsum und der Migrationsgeschichte des Angeklagten, den Gegenden, in denen er sich aufhält, und Gewaltdelikten. In seinem Schlussplädoyer sagt der Anwalt, sein Mandant sei ein sehr junger Mann, der aufgrund seines Konsums, seiner Migrationsgeschichte und der Tatsache, dass er sich immer in dieser „drogenverseuchten“ Gegend aufhielt, „Verbrechen auf sich geladen“ habe. Bei der Urteilsverkündung bekräftigt der Richter, dass er den Angeklagten für einen „feinen Kerl“ halte, wenn er nur nicht immer in diesen Gegenden, in denen Drogen verkauft werden, sein Unwesen treiben würde. Die harte Gefängnisstrafe von sieben Jahren, einschließlich der obligatorischen Drogentherapie nach zwei Jahren Haft, wird als Chance zur Selbstverbesserung und zur Berufsausbildung dargestellt. Der Richter fügt hinzu, dass das Gericht nicht weiß, ob der Mann nach seiner Entlassung in Deutschland bleiben, geschweige denn arbeiten dürfe, aber dass der Angeklagte diese Strafe dennoch als Chance sehen sollte, an sich zu arbeiten.