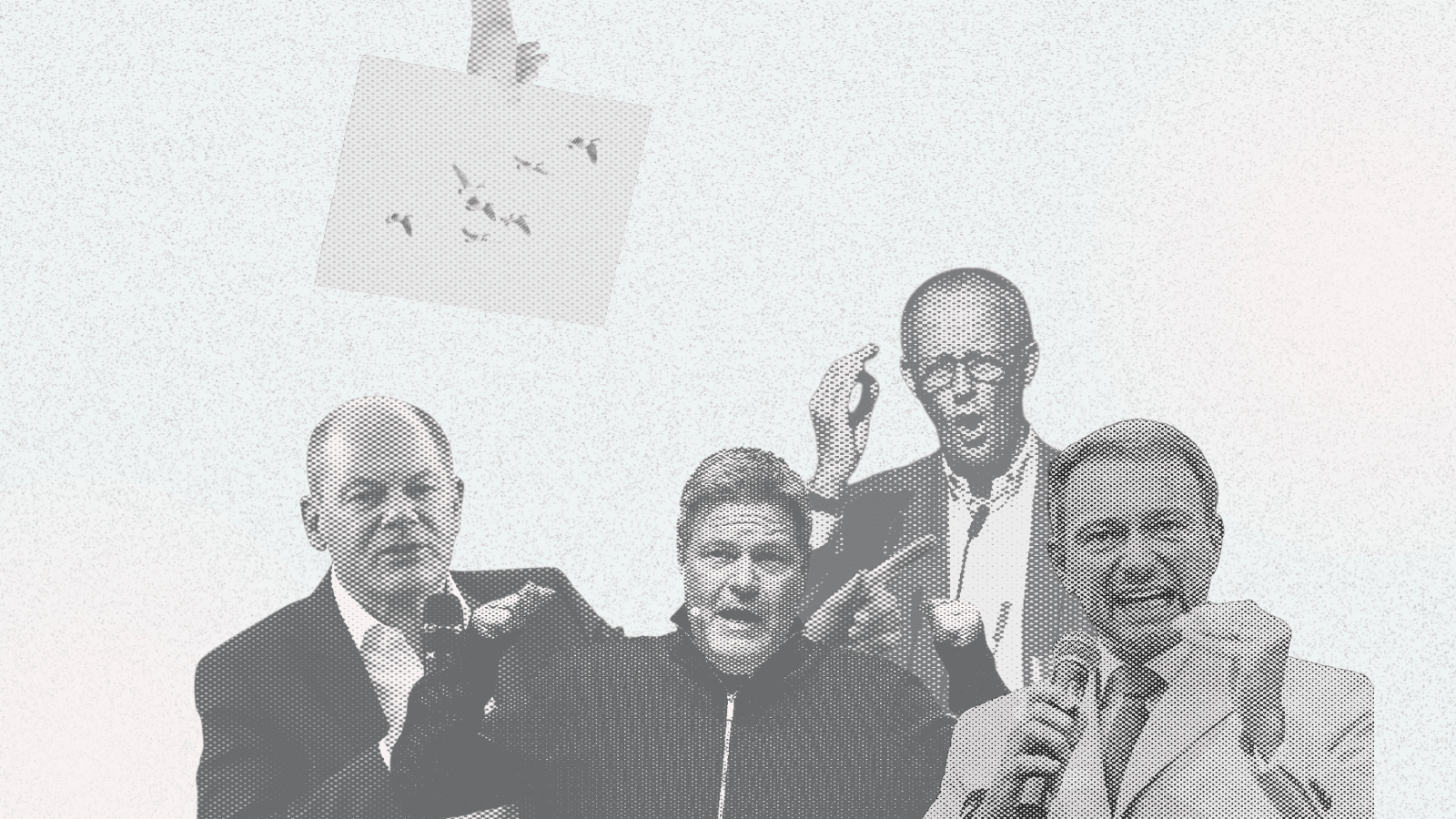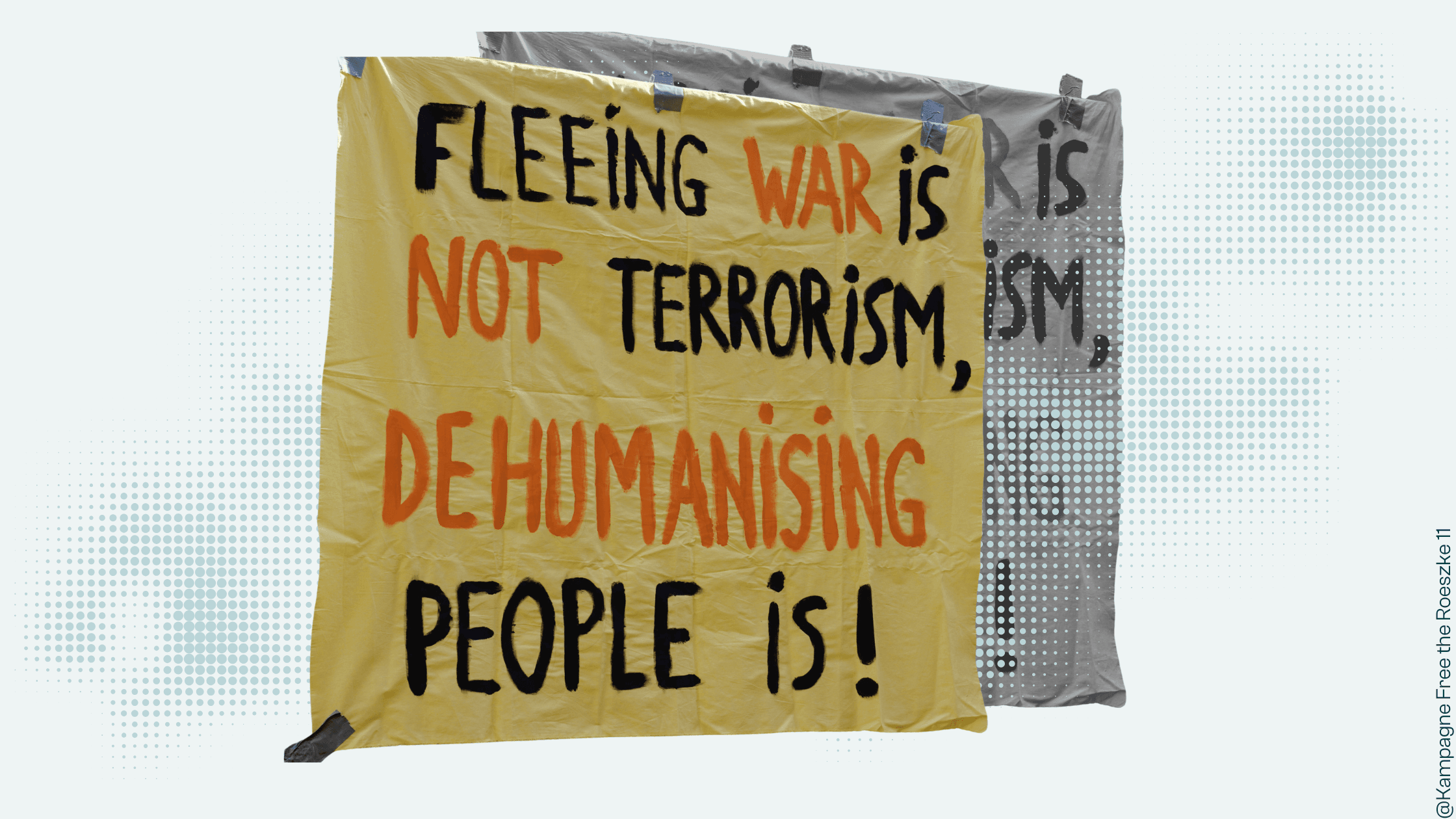Fall 19
| Fallnummer | 19 |
| Anklage | Diebstahl |
| Verteidigung anwesend | Ja |
| Übersetzung anwesend | Ja |
| Rassifizierte Person | Ja |
| Ausgang | Haftstrafe |
Nach mehr als sechs Wochen in Untersuchungshaft wegen geringfügigen Diebstahls wird ein junger Mann mit sechs weiteren Monaten Haft bestraft. Der Richter, der Staatsanwalt und sogar sein Anwalt betonen ihre Hoffnung, dass die harte Strafe ihn dazu bewegen wird, in sein früheres Wohnsitzland zurückzukehren.
In diesem Fall wird sichtbar, wie Kriminalisierung als Ausweisungsinstrument fungiert. Das Gericht gibt ungewöhnlich offen zu verstehen, dass es sich harter Strafen als einer Art Grenzmechanismus bedient. Migrantisierte Menschen, die es als unerwünscht ansieht, sollen dazu gebracht werden, aus Deutschland auszureisen. Das Urteil ist wesentlich härter als in vielen anderen Fällen geringfügigen Diebstahls, die wir beobachtet haben. Diese ziehen selten Gefängnisstrafen nach sich, vor allem nicht ohne Bewährung.
Der Fall ist auch ein Beispiel für die Ausbeutung der Arbeitskraft von Menschen im Gefängnis. Diese werden deutlich unter Mindestlohn bezahlt. Obwohl der angeklagte junge Mann in diesem Fall außerhalb des Gefängnisses keine Arbeitserlaubnis hat, was seine prekäre finanzielle Lage bedingt, wird seine Arbeitskraft hinter Gittern umso mehr ausgebeutet. Sein Aufenthalts- und Migrationsstatus strukturieren seine Erfahrung mit dem Gefängnis und dem Strafsystem im Allgemeinen.
Die angeklagte Person in diesem Fall ist ein junger Mann, der sich seit einigen Jahren in Deutschland aufhält und zuvor in ein anderes europäisches Land eingewandert war. Dort hatte er zwei Berufsabschlüsse erworben und hat dort auch Familie. Mit seinem Aufenthaltsstatus darf er in Deutschland nicht arbeiten (zumindest nicht außerhalb der Haftanstalt) und erhält keine Sozialleistungen.
Ihm wird vorgeworfen, Kleidung im Wert von weniger als 100 € in einem Geschäft gestohlen zu haben. An dem besagten Tag hielt ihn Sicherheitspersonal an und er brachte die Waren zurück in den Laden, wo sie wieder für den Verkauf einsortiert wurden. Bei der Verhandlung gibt der Betroffene den Diebstahl zu, sodass es vor allem darum geht, das Strafmaß zu bestimmen.
Der Strafverteidiger liefert einige Hintergrundinformationen. Unter anderem benennt er noch einmal, dass sein Mandant in Deutschland nicht arbeiten darf. Dieser Fall sei seine dritte Anklage wegen Diebstahls, und er sei bereits zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im Gefängnis habe er ein geringes Einkommen erzielt, doch sei ihm nach seiner Entlassung bald das Geld ausgegangen.
Der Richter fragt den Mann, was er mit der gestohlenen Kleidung vorgehabt habe. Dieser antwortet, dass er nichts zu essen gehabt habe und seine Kleidung schmutzig gewesen sei. Daraufhin antwortet der Richter, er hätte im Gefängnis Geld sparen sollen, und scherzt, dass man Kleidung ohnehin nicht essen könne.
In seinem Plädoyer fordert der Staatsanwalt eine sechsmonatige Freiheitsstrafe und die Entlassung des Angeklagten aus der Untersuchungshaft. Er sagt, der Mann solle seinen Aufenthalt in Deutschland überdenken. Er könne die Zeit vor Beginn seiner Gefängnisstrafe nutzen, um zu überlegen, ob er nicht in sein früheres Wohnsitzland zurückkehren wolle. Der Verteidiger ergänzt, dass sein Mandant qualifiziert sei, anderswo Arbeit zu finden, dass er in Deutschland allerdings keine Zukunft für ihn sehe. Er beantragt eine viermonatige Freiheitsstrafe.
Der Richter verurteilt den Mann zu sechs Monaten Haft. Er gibt ihm zu verstehen, dass er meint, es würde dem Mann in seinem früheren Wohnsitzland sicher besser ergehen. Er äußert die Hoffnung, der Angeklagte würde zu dem Schluss kommen, dass zurückzukehren besser sei, als weitere Zeit im Gefängnis in Deutschland zu verbringen.