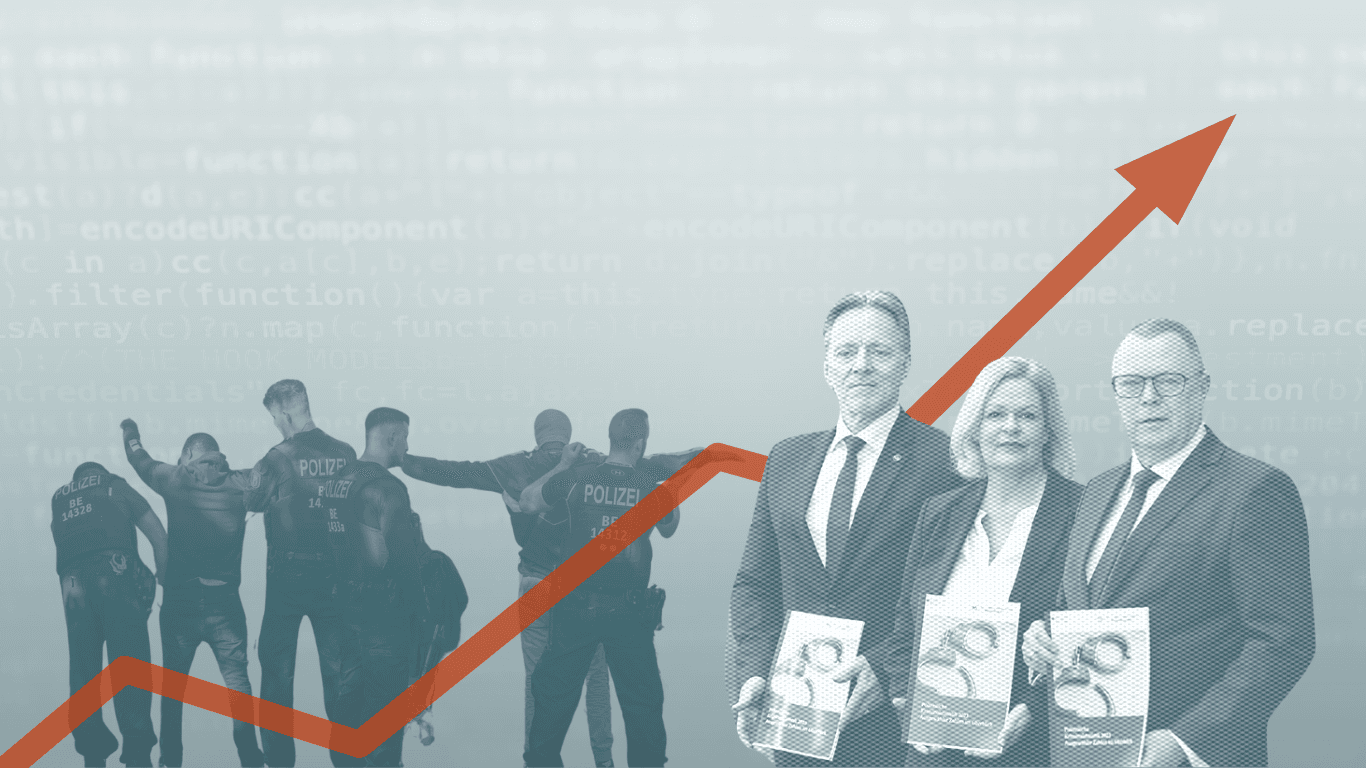Fall 16
| Fallnummer | 16 |
| Anklage | Sonstige |
| Verteidigung anwesend | Ja |
| Übersetzung anwesend | Nein |
| Rassifizierte Person | Ja |
| Ausgang | Geldstrafe |
Ein junger Mann wird aufgrund seiner Äußerungen bei einer Polizeikontrolle wegen Beleidigung verurteilt. Das Gericht berücksichtigt weder die Entschuldigung des Mannes noch die Tatsache, dass dieser die Kontrolle als diskriminierend empfand. Als ihm eine härtere Strafe angedroht wird, akzeptiert er die hohe Geldstrafe, gegen die er Einspruch eingelegt hatte.
In ihrem Buch Crook County beschreibt die US-amerikanische Soziologin Nicole Van Cleve Strafgerichtsverfahren als rassistische Erniedrigungszeremonien: „Vor Gericht können Staatsbedienstete ein zeremonielles Schauspiel vorführen, das den Anschein von Fairness erweckt. Dabei bleibt rassistische Diskriminierung hinter bürokratischen Vorgängen, gerichtlichen Abläufen sowie fehlender Aufsicht und Rechenschaftspflicht verborgen. Es ist eine Art staatlich legitimierte rassistische Gewalt, bei der weiße Beamt*innen unter dem Deckmantel der Verbrechensbekämpfung über Schwarze und Latinx Personen moralisch urteilen und sie bestrafen können.“ Obwohl in Deutschland auch andere rassifizierte Gruppen besonders betroffen sind, können wir in diesem Fall eine ähnliche Dynamik beobachten.
Der Prozess wirkt auf die Prozessbeobachter*innen wie inszeniert, so als wäre er eine rituelle Bestrafung und Demütigung dieses rassifizierten Mannes. Unter anderem hat dieser es nämlich gewagt, die Polizeikontrolle als diskriminierend zu bezeichnen. Der Richter fragt die als Zeugen geladenen Polizeibeamten, wie der Betroffene Wiedergutmachung leisten könne. Das ist demütigend und zeigt, auf wessen Seite das Gericht steht. Den Polizisten ist die Genugtuung anzusehen, als sie – vom Richter aufgefordert – ihre Macht erneut demonstrieren dürfen und von dem Angeklagten verlangen, sich öffentlich zu entschuldigen. Am Ende der rassistischen Erniedrigungszeremonie stellt der Richter Fragen, die stark in die Privatsphäre des Mannes eindringen, aber das Urteil nicht beeinflussten.
Der Beschuldigte arbeitet als Mechaniker und erscheint in Arbeitsuniform zur Anhörung. Die Staatsanwaltschaft verliest die Anklage, wodurch wir eine Version der Geschehnisse erhalten, die sich an dem besagten Tag zugetragen haben sollen. Der Mann wurde von zwei Polizeibeamten kontrolliert, die ihn später aufgrund seiner Äußerungen wegen Beleidigung anzeigten. Er erhielt einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von mehr als 2.000 €. Dagegen legte er Einspruch ein.
Bei seiner Vernehmung gibt der Betroffene seine Version der Ereignisse wieder. Er erklärt, dass er die Gründe für die Polizeikontrolle nicht verstanden und die Kontrolle als diskriminierend empfunden habe. Die Polizei habe ihm nicht erklärt, warum er sich ausweisen musste, und deshalb habe er sich geweigert, dies zu tun. Daraufhin habe der Polizist seine Freundin gefragt, was sie „von so einem Loser“ wolle. Er habe diese Bemerkung als unangemessen empfunden und deshalb mit der Beleidigung reagiert, die ihm später zur Last gelegt worden sei.
Der Richter stellt keine weiteren Fragen. Er teilt dem Mann mit, dass er die Aussage der beiden als Zeugen geladenen Polizisten in diesem Fall für glaubwürdig halte. Der Mann werde wahrscheinlich eine härtere Strafe bekommen, wenn er seinen Einspruch gegen den Strafbefehl nicht zurückziehe.
Der Verteidiger geht auf die Bemerkungen des Richters ein und beschränkt den Einspruch seines Mandanten auf die Rechtsfolgen. Das bedeutet, der Einspruch richtet sich nur noch gegen die Höhe der Geldstrafe, nicht gegen den Strafbefehl und den damit verbundenen Vorwurf an sich. Das Gericht ruft die als Zeugen geladenen Polizisten in den Gerichtssaal und fragt sie, ob der Mann eine Wiedergutmachung leisten (und somit eine niedrigere Geldstrafe erhalten) könnte. Einer von ihnen bittet um eine öffentliche Entschuldigung, woraufhin der Richter mit den Achseln zuckt und den Betroffenen mit einer Geste auffordert, dies zu tun. Der Mann entschuldigt sich. Der Richter bittet die Polizisten, zu bestätigen, dass sie die Entschuldigung annehmen.
Anschließend stellt der Richter detaillierte Fragen zum Substanz- und Alkoholkonsum des Angeklagten, zu seinen familiären Beziehungen (unter anderem auch, wie das Verhältnis zu seinen Schwestern sei) und zu seinen Hobbys. Außerdem wird er zu seiner finanziellen Situation befragt. Doch all diese Fragen haben keinen Einfluss auf das Urteil. Es bleibt bei der Geldstrafe in Höhe von über 2.000 €.