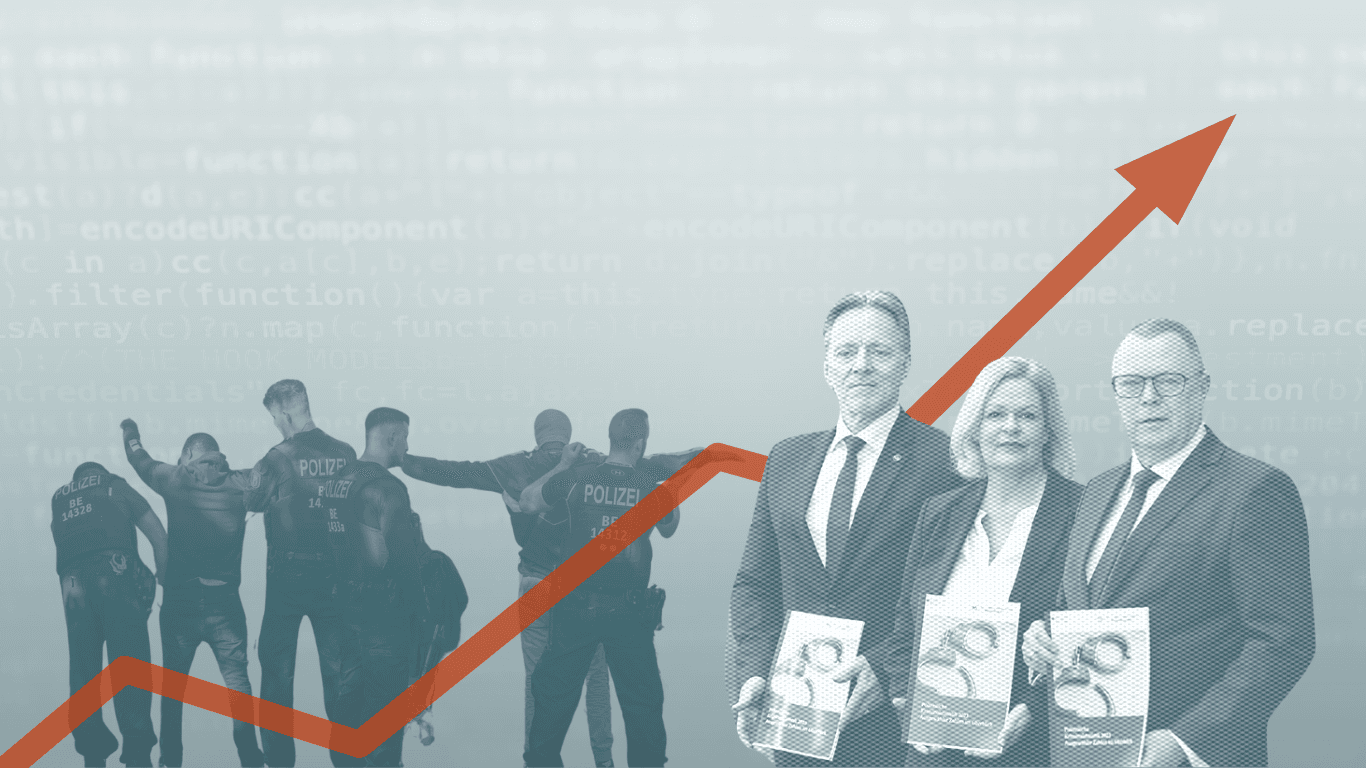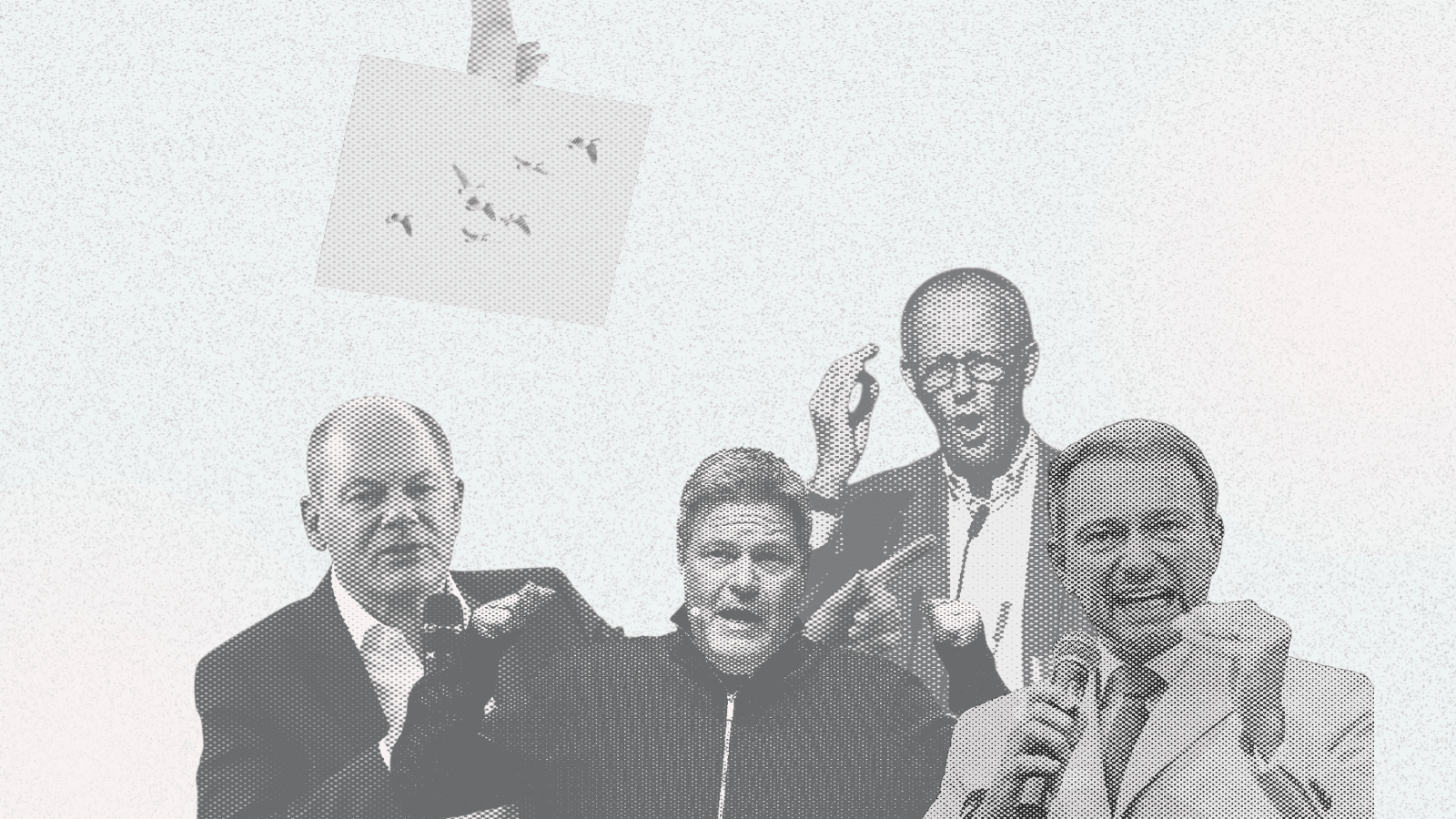Fall 14
| Fallnummer | 14 |
| Anklage | Diebstahl |
| Verteidigung anwesend | Ja |
| Übersetzung anwesend | Ja |
| Rassifizierte Person | Ja |
| Ausgang | Haftstrafe |
Ein junger, rassifizierter Mann befindet sich seit über einem Monat in U-Haft. Er wird wegen sechsfachen Diebstahls zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Eine Rolle in dem Verfahren spielt, dass er wiederholt von der Polizei an einem so genannten „kriminalitätsbelasteten Ort“ kontrolliert wurde. Einige daraus resultierende Verfahren gegen ihn werden zwar eingestellt, tragen aber dazu bei, dass das Gericht dem Mann eine „kriminelle Energie“ zuschreibt.
Bei der Verurteilung hält die Richterin dem Mann vor, dass er zuvor von der Polizei an einem „kriminalitätsbelasteten Ort“ kontrolliert wurde. Das sind Gegenden, die die Polizei als besonders „gefährlich“ eingestuft hat und dadurch verdachtsunabhängige Kontrollen mit eventuell weiteren Folgemaßnahmen durchführen darf, was sonst nur bei Bestehen eines „Anfangsverdachts“ rechtlich möglich ist. Meist handelt es sich dabei um migrantisch geprägte Gegenden. Verdachtsunabhängige Kontrollen begünstigen Racial Profiling als gängige Polizeipraxis, welche für die Betroffenen zumeist sehr demütigend ist, da sie in der Öffentlichkeit stattfindet und gerade dadurch noch einmal rassistische Bilder reproduziert. Der Mann wird also härter bestraft, weil er in einem Gebiet angehalten wurde, das der polizeilichen Praxis des Racial Profiling einen Deckmantel der Legitimität bietet. Als wäre die gängige Praxis, immer härtere Strafen gegen Menschen zu verhängen, die straffällig werden, nicht ungerecht genug, zieht die Richterin frühere Anzeigen gegen den Mann für die Strafzumessung heran, obwohl diese fallengelassen wurden. Racial Profiling schafft somit einen sich selbst verstärkenden Kreislauf, da die bloße Kontrolle Menschen zu „Kriminellen“ macht, was dann wiederum als Rechtfertigung für diese Praxis dient und härtere Strafen zur Folge hat.
Strafverschärfend wirkte sich in diesem Fall auch aus, dass das Gericht dem Mann „gewerbsmäßigen“ Diebstahl vorwirft, weil er in kurzer Zeit mehrere Straftaten begangen haben soll. Laut Gesetz müsste er mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren bestraft werden, wenn jeder der Diebstähle einen Schaden von mehr als 50 EUR verursacht hat (§ 243 Abs. 1 Nr. 2 StGB). Dieses Gesetz (§ 243 Abs. 1 Nr. 2 StGB) wurde von Expert*innen als Armutsstrafe und Diskriminierung von Menschen mit Suchterkrankungen kritisiert. Menschen, die aus Not und damit regelmäßig stehlen, werden durch diesen Paragrafen härter bestraft. Dabei sollte eine Sucht als strafmildernder Faktor berücksichtigt werden, insbesondere wenn die Person ausschließlich gestohlen hat, um ihre Sucht zu finanzieren, und nicht für grundlegende Bedürfnisse wie Miete oder Kleidung. Dass der Mann in diesem Fall angibt, er habe wegen seines Substanzkonsums gestohlen, findet im Strafmaß gar keine Berücksichtigung.
Das Verfahren beginnt damit, dass der Betroffene aus der Untersuchungshaft vorgeführt wird, in der er sich seit über einem Monat befindet. Es wird erwähnt, dass er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass er wegen sechs Fällen von „gewerbsmäßigem“ Diebstahl in Untersuchungshaft sitzt.
Nachdem die Einzelheiten der mutmaßlichen Vorfälle verlesen worden sind, erklärt der Verteidiger, dass sein Mandant die ihm vorgeworfenen Taten gestehe. Sein Mandant habe zum Zeitpunkt der Vorfälle über kein Einkommen verfügt und sei nicht in der Lage gewesen, Arbeit zu finden. Er erwähnt auch, dass sein Mandant regelmäßig Substanzen konsumiere (ein strafmildernder Umstand), geht aber erst nach Aufforderung der Richterin näher darauf ein. Der Betroffene erklärt, dass er regelmäßig Substanzen konsumiere und Diebstähle verübt habe, um seinen Konsum zu finanzieren.
Die Richterin führt aus, dass der Mann ihren Informationen zufolge der Polizei bekannt gewesen sei, die ihn mehrfach an einem „kriminalitätsbelasteten Ort“ angehalten habe. Einmal seien bei dem Mann angeblich Drogen gefunden worden, aber die Staatsanwaltschaft habe alle Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorwurf des Drogenhandels eingestellt.
Die Staatsanwältin beantragt eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten ohne Bewährung. Sie begründet dieses Strafmaß zum Teil damit, dass die Straftaten kurz hintereinander erfolgt seien und dass damit Vorsatz und ein „geschäftsmäßiges Vorgehen“ erkennbar seien. Der Anwalt des Mannes stimmt der Staatsanwältin teilweise zu, sagt aber auch, dass sein Mandant ein Problem mit Substanzkonsum gehabt habe und keine Arbeit finden konnte. Er plädiert auf eine achtmonatige Haftstrafe auf Bewährung.
Letztendlich wird der Mann zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Bei der Urteilsbegründung sagt die Richterin, sie habe berücksichtigt, dass der Mann mehr als einen Monat in Untersuchungshaft verbracht habe, was, wie sie sagt, „für einen Nicht-Muttersprachler nicht ganz einfach ist“. Sie glaube zwar, dass Substanzkonsum bei den Straftaten eine Rolle gespielt habe, aber auch, dass der Angeklagte „gewerbsmäßig“ vorgegangen sei. Sie geht auch auf die Polizeikontrollen am kbO ein und sagt, dass die häufigen Polizeikontrollen offenbar keinen „nachhaltigen Eindruck“ auf ihn gemacht hätten. Angesichts dieser Punkte könne sie nicht erkennen, wie jemand wie er (sie betont dieses Wort) ohne Therapie und Rehabilitation auf einen positiven Weg kommen könnte.